Im Museum für Wasserkocher
„Brettl vor’m Kopf“
Eine Kabarettsoirée in der Wiener Volksoper unter dem Motto „50 Jahre später“
kabarett.at / 5. November 2005
Eine Kabarettsoirée aus Anlass des 50-Jahr-Gedenkens. Grundsätzlich eine feine Idee. Auch dem damaligen kleinkünstlerischen Widerspruch und der satirischen Unterhaltung sollen in diesem Jubiläumsjahr eine Bühne geboten werden. Gut so. Die 50er-Jahre werden ja oft und gerne als die „Goldene Zeit“ des Wiener Kabaretts bezeichnet. Geprägt von der ehrwürdigen „namenlosen Gruppe“ rund um Bronner, Qualtinger, Kreisler und Merz. Um u.a. diesen zu huldigen, kam man vergangenen Donnerstag in die Volksoper. Doch aus dem gewiss als frohsinnig und informativ geplanten Potpurri ward in Summe ein doch ziemlich tristes Museum für Memorabilia. Über die mangelnde Stimmung hinwegzutäuschen vermochte nicht einmal der gewohnt charmante Plauderton von Christoph Wagner-Trenkwitz (Konzept & Conférence). Und das will etwas heißen.
Dabei hätte es ein durchaus bunter Abend werden können. Und ein paar Farbflecke gab es ja auch. Agnes Palmisano und ihren beiden Musikern Roland Sulzer (Akkordeon) und Peter Havlicek (Kontragitarre) gelangen sogar derer drei. Denn sie verließ sich bei ihren Interpretationen nicht nur auf die vermeintlich ablaufsdatumsfreie Wirksamkeit altbekannter Klassiker. „Verrückt nach Verrückten“ zählt nicht zu Bronners bekanntesten Liedern. Kreislers „Bidla Buh“ verpasste sie einen adaptierten Text. Und für die Darbietung von Hugo Wieners „Man kann mit den Pokornys nicht verkehren“ schlüpfte sie in die Rolle eines herzig unterbelichteten Hausmädchens.
Elfriede Ott gelang es indes erstaunlicherweise, sich alle gebotenen Vorschuss-Sympathien mit einer quälend langen Weigel-Ballade am Ende eines ohnedies schon quälend langen Abends zu verscherzen. Wobei das Wort „verscherzen“ hier völlig fehl am Platz ist …
Betont bestens gelaunt zeigte sich vorher Gerhard Ernst. Ein Fall für sich. Was muss in einem Menschen vorgehen, der schon für die Ansage eines Liedes, das er weder geschrieben noch komponiert hat – und in dessen Glanz er sich nur vorübergehend sonnt, das Publikum schamlos zu Szenenapplaus nötigt. Von einem Scheibchen dieser Selbstherrlichkeit könnten ganze Großfamilien jahrelang leben. Dabei ist an seinen Interpretationen ja grundsätzlich nichts auszusetzen. Von der Physiognomie bis zur Intonation ganz das Original. Höchstens mit etwas mehr Sinn für darstellerische Komik. Bei Qualtinger entstand der Witz ja oft unter tatkräftiger Mitwirkung seiner mimischen Zurückhaltung, um seinem eingeschlafenen Gesicht hier gebührend Tribut zu zollen. Das kopieren zu wollen, hätte sich tatsächlich leicht als Fehler erweisen können. Der penetrante Beigeschmack bleibt. Denn eine Hommage verlangt immer auch eine Spur Demut. Und davon ist im Ernst nichts zu spüren.
Bei Hartmut Hudezecks kreuzbraven Kreisler-Interpretationen sollten indes die zuständigen Anwälte tätig werden. Wegen vorsätzlicher Humorlosigkeit.
Im Vergleich dazu wirken die Lieder des Kreisler-Jüngers Alexander Kuchinka plötzlich wie ein sprudelnder Quell heiteren Amusements. Ihn aber deshalb gleich als einen der besten jungen Kabarettisten dieses Landes vorzustellen, wird dem versierten Regisseur und Kleinkünstler nicht nur wegen seiner bald 40 Lenze nicht ganz gerecht. Christoph Wagner-Trenkwitz ist nicht der erste, der mit seinem Ansinnen, Kuchinka und seine Lieder berühmt machen zu wollen, scheitern wird. Das sind vor ihm schon u.a. Gerhard Bronner, Louise Martini und Peter Hofbauer. Indem man den Kärntner bereits zu Lebzeiten in die Ahnengalerie des Kabaretts einreiht, tut man ihm gewiss keinen Gefallen.
Woran liegt’s ? Kuchinka kann rasant reimen, pointiert texten und sich dabei auch noch flott am Klavier begleiten. Aber es klingt eben alles nach Schellack. Und das nicht etwa aus Versehen, sondern vorsätzlich. Stilistisch, musikalisch und sprachlich – alles fast schon frühes 20. Jahrhundert. Und das ganz ohne ironische Distanz, sondern mit Fleisch und Blut. Entertainment für jene, deren Verständnis für Humor spätestens in den 50ern in Mark und Bein gemeißelt wurde. Oder jene Jüngeren, die ihre unverrückbare kabarettistische Prägung über die Schallplatten der Eltern erfahren haben. Warum macht er das nur ? Rein schon aus kommerziellen Erwägungen ist es doch unsinnig, sich ein Publikum erspielen zu wollen, das ihm schon bald wegsterben wird. Von der künstlerischen Motivation ganz zu schweigen.
Aber immerhin : Kuchinka ist der Einzige, dem mit seinen Songs ansatzweise der Brückenschlag aus der Vergangenheit in die – wenn auch starr rückwärts gewandte – Gegenwart gelingt.
Die meisten anderen Original-Klassiker wirken im Rampenlicht des Jahres 2005 wie aschfahle Schatten ihrer selbst (Hudezeck) oder verzweifelt um Zeitlosigkeit rudernde Relikte einer vergangenen Epoche (Ernst), in der ganz offensichtlich auch nur mit Wasser gekocht wurde. Zugegebenermaßen sehr gekonnt. Aber von wegen unsterblich. Nostalgisches Flair und sehnsüchtige Reminiszenz konservieren nur im Auge des Betrachters. Zeitdokumente dieser Güteklasse bedürfen daher eines ganz besonders behutsamen Umgangs. Ohne adäquaten Nährboden und frische Luft verkommen sie zu untoten Kabarett-Zombies, die wahrscheinlich so lange wie Zirkuspferde durch die Manegen gejagt werden, bis sie und der letzte Fan zu Staub zerfallen sind. Gnadenlos. So ein Ende hat weder Bronners „Halbwilde“ noch Kreislers „Politiker“ verdient. Und schon gar nicht, dass einem bei deren Vorführung vor allem eines ist: fad. (pb)
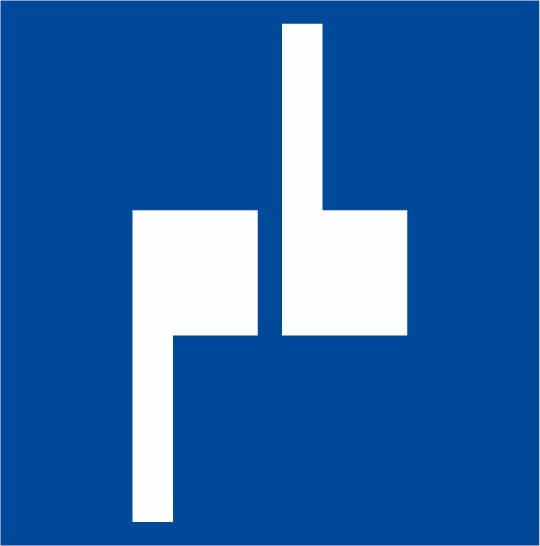

0 comments on Im Museum für Wasserkocher